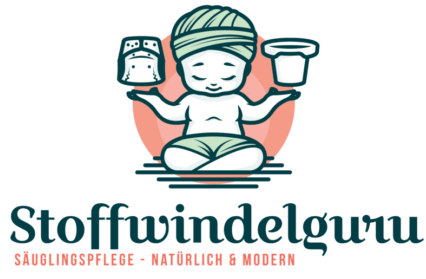Viele unserer Beiträge beziehen sich auf das Saugvolumen von Windeln. Dieses muss besonders hoch sein, damit die Windel lange hält. Mit Stoffwindeln haben wir schier unendliche Möglichkeiten eine Windel zu boosten – das Intervall zu verlängern. Doch wie lange sollte eine Windel eigentlich halten und welchen Einfluss hat das Wickelintervall aufs Kind und seine Ausscheidungswahrnehmung?
Eine Windel, die ein hohes Saugvolumen hat und vier bis fünf Stunden am Kind hält ist manchmal total praktisch, keine Frage. Sie hilft uns z. B. einen langen Ausflug zu überbrücken, bei dem es unterwegs keine adäquate Wickelmöglichkeit gibt. Sie kann uns in anstrengenden Phasen auch helfen, einfach kurz durch zu atmen und nicht permanent ans Wickeln denken zu müssen.
Was es aber nicht sein sollte: Eine alltägliche Vermeidungsstrategie. Wickeln ist ein elementarer Baustein in der Beziehungspflege und der Selbstwahrnehmung des Kindes.
Eine gute Richtschnur sind circa alle 2 Stunden, oder aber nach dem zweiten bis dritten Pipi. Das Kind sollte nicht allzu lange in einer nassen Windel sitzen. Nässe ist kein normales Gefühl für das Baby. Stay Dry Liner sind leider auch keine generelle Lösung, da die Ausscheidung hiermit weniger wahrgenommen werden kann.
Was lernt das Kind bei einem regelmäßigen, auf das Kind eingehenden Wickelintervall?
- Nässe-Feedback: Wenn ich Pipi mache, werde ich nass.
- Wickel-Kommunikation: Wenn ich Pipi gemacht habe und es nass ist, werde ich gewickelt. Nässe ist nicht der Normalzustand
- Bindung durch Wickeln: Wickeln soll kein ’schnell schnell‘ und vor allem kein Kampf gegen das Kind sein, sondern eine gemeinsame, liebevolle Routine. Kommunikation und Achtsamkeit sind hier die Schlüsselwörter.
Was kann aber passieren, wenn wir ein Kind dauerhaft in einer nassen Windel lassen? Es wird immer wiederholt ein bisschen Pipi machen statt im Schwall. Das Kind hält den Urin also nicht an – eine körperliche Notwendigkeit, aber auch eine wichtige Voraussetzung auch fürs spätere Trocken werden.
Woher weiß ich aber, wann bzw. wie oft mein Kind Pipi macht? Versuch es mit Windelfrei! Zuhause kann man das Baby wunderbar eine Zeit lang ohne Windel lassen und sehen, wie oft das Kind uriniert. Hierfür gibt es auch praktische Krabbel/Wickeldecken (Link). Oder man nimmt einfach alte Handtücher. Dieser Tipp ist bis zum Ende der Wickelzeit immer mal wichtig, denn das Ausscheidungsverhalten verändert sich zwar ständig, hat aber über gewisse Phasen durchaus Routine. Beispielsweise kommt während der Beobachtung manchmal über eine Stunde lang gar nichts – man findet also ohne Windel einfach viel besser in den Rhythmus des Kindes hinein. Man erkennt auch prima, ob das Kind einfach im Schwall drauf los pinkelt oder vorher eindeutige Signale sendet (Stichwort: Abhalten). Lege ich die Windel nach dem Urinieren an, weiß ich auch ziemlich zuverlässig, dass das nächste Pipi in etwa einer Stunde kommen könnte. Je älter das Kind, desto bewusster und länger kann dieses Intervall werden.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Größe des Windelpakets. Eine Windel mit einer dünnen Einlage oder Mullwindel, die ‚nur’ zwei mal Pipi aushalten muss, ist deutlich dünner als ein Paket aus Mullwindel und Booster, welches 4-6 Stunden halten soll. Auch wenn große Windelpakete keine Schäden anrichten, so ist ein kleines Paket flexibler, weicher und schränkt bei Bewegungen weniger ein. Einige Kinder sind mit schmaleren Paketen auch deutlich zufriedener.
Zu guter Letzt sollten schwierige Wickelphasen (‚Streiks‘) nicht dazu führen, das Wickeln so lange wie möglich herauszuzögern. Diese Zeit verlangt oftmals viel ab, bringt uns aber dem Kind auch näher: Was braucht mein Kind? Kann ich zum Beispiel einfach (je nach Entwicklungsstand) nicht im Liegen wickeln sondern im Stehen oder im Krabblen? Wie kommunizieren wir dabei mit dem Kind? Streiks setzten sich vor allem dann fest, wenn wir als Eltern nicht mit dem Entwicklungsstand des Kindes gehen. Viele Kinder wollen irgendwann nicht mehr passiv auf dem Rücken liegend gewickelt werden. Das Kind möchte von Anfang an in den Wickelablauf eingebunden werden, in seinen Möglichkeiten. Ob das Anfangs einfach eine begleitende, warme Stimme ist, die das Kind auf Bewegungen aufmerksam macht oder später die Mitentscheidung bei der Windelauswahl ist.
Wickeln ist kein notwendiges Übel, wickeln ist Liebe.